
Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Reisen der Mitglieder der Jury Spiel des Jahres, die unterwegs sind, neue Spiele und neue Mechanismen zu erforschen. In ihren jeweiligen Medien dringen sie dabei bis zu einem Sitz im mysteriösen Rat der Schatten vor. Ob sie dort auch Mitglied werden und ob „Council of Shadows“ (Martin Kallenborn und Jochen Scherer bei Alea) ein spannendes Weltraumabenteuer ist, steht in den Sternen dieser Kritikenrundschau.
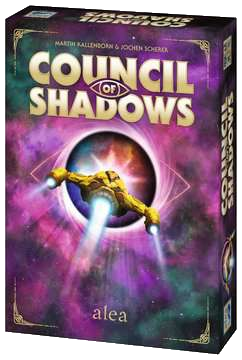
„Wir starten mit denselben sechs Karten. Mit jeweils drei davon programmiere ich meinen Zug und führe dann erst Karte A, dann Karte B und schließlich Karte C aus. Die meisten Karten ‚verbrauchen Energie‘ oder anders ausgedrückt: Sie lassen meinen Zielmarker voranpreschen. Je stärker die Aktion, desto weiter. Ich kann (und sollte) Rohstoffe investieren, um mir nach und nach Aktionskarten mit einem besseren Verbrauch-Leistungs-Verhältnis zu kaufen“, erklärt Udo Bartsch das Spiel. „Mit meinen Aktionen entdecke ich neue Sonnensysteme, gründe Dependancen auf verschiedenen Planten innerhalb meiner Reichweite und/oder schürfe vor Ort Rohstoffe. Am Ende meines Zuges darf ich jede Galaxie, in der ich mich befinde, werten. Besitze ich dort die meisten Siedlungen, gewinne ich viele Punkte. Besitze ich nicht die meisten Siedlungen, zählt es weniger. Doch in beiden Fällen kostet mich die Wertung eine meiner Siedlungen. Damit erleichtere ich es anderen, hier ebenfalls zu Punkten zu kommen. Und ich muss Aktionen aufwenden, um meine verlorene Präsenz wiederherzustellen. Gerade bei Spielbeginn ist das ein erheblicher Tempoverlust. Andererseits: Mit so wenigen Punkten wie bei Spielbeginn wird sich mein Zielstein nie wieder einholen lassen.“
Der Clou ist für Bartsch der Wettlauf mit dem Zielstein: Der „verstrickt mich von Beginn an in spannende Widersprüche: Ich will starke Aktionen machen – aber damit bürde ich mir Schulden für die Zukunft auf. Ich kann sparsam agieren – wachse dann aber nur sehr langsam“, schreibt er. „Auch wenn ich meinen mehrteiligen Zug im Geheimen austüftle, ist ‚Council of Shadows‘ kein solitäres Gemümmel: Wir kaufen uns gegenseitig Aktionskarten weg, blockieren Siedlungsplätze und ganze Galaxien, lauern auf Gelegenheiten für leichte Mehrheiten.“ Sehr reizvoll findet er die Dynamikänderungen, die sich durch Levelaufstiege ergeben. Dabei sei „Council of Shadows“ kein überkomplexes Spiel. „Alles folgt klaren Prinzipien, es gibt kaum Kleinregeln.“ Bartsch sieht hier eine gewisse „Gradlinigkeit“, dennoch passierten Planungsfehler. „Vor allem, weil jemand übersieht, auf welche Sektoren sich die Aktionskarten auf den Plätzen A, B und C beziehen. Und so will man eine Aktion irgendwo ausführen, wo es gar nicht erlaubt ist – was vielleicht auch eine etwas unnötige Klippe in diesem Spiel darstellt. Und noch eine zweite Klippe gibt es: die nicht ganz intuitive Symbolik. Sie führt in Erstpartien zu ganz vielen Nachfragen.“
Die einzelnen Komponenten des Spiels seien „unspektakulär“, schreibt Bartsch. „Außerordentlich wird das Spiel für mich durch die übergeordnete Idee, dass mein Punktezähler einem anderen Zähler hinterherläuft, dessen Geschwindigkeit ich steuern kann. Dieser Dreh bewirkt, bekannte Abläufe im Spiel neu denken und bewerten zu müssen. Ich finde den Mechanismus derart stark, dass ich glaube, er könne in Zukunft noch weitere Spiele tragen und zu einem Markenzeichen von Martin Kallenborn und Jochen Scherer werden.“¹
Stefan Gohlisch sieht in „Council of Shadows“ „Kolonialismus und Ausbeutung, in einem Science-Fiction-Kontext zwar und in keinem historischen. Man kann das problematisch finden, und das Kulturgut Spiel ist eigentlich weiter“, schreibt er. „Wem die fantastische Verpackung genügt, um über das Thema hinwegzusehen, der sollte einen Blick auf dieses Kennerspiel riskieren. Mechanisch ist es das wert.“ Für Gohlisch verbindet das Spiel „moderne Mechanismen wie Deckbau, Arbeitereinsatz und Gebietskontrolle mit einer originellen Wertung.“ Dazu würde das zwar komplexe Geschehen „durch eine sehr klare Bildsprache illustriert. Was möglich ist, kann jederzeit auf dem eigenen Sichtschirm abgelesen werden, was darüber hinwegsehen lässt, dass er für seinen eigentlichen Zweck – die Blickdichte – viel zu schmal ist“, schreibt Gohlisch, und findet es einen „spannenden Wettlauf“ um Punkte. „‚Council of Shadows‘ ist im Guten wie im Schlechten ein Paradebeispiel für das, was weltweit als ‚German Games‘ bekannt wurde. Fein austarierte Mechanismen stehen einer großen Laxheit bei der thematischen Einkleidung gegenüber. Es wirkt ein wenig wie ein Letztes seiner Art – ein spielerisch sehr reizvolles.“²

Auch Manuel Fritsch ist in die unendlichen Weiten aufgebrochen, und hat zunächst viel Lob für den Verlag übrig: „Alea ist wieder zu alter Stärke aufgefahren. Das ist mit Abstand eines der besten Spiele, die in den letzten Jahren bei Alea herausgekommen sind. Punkt“, sagt er. Zwar sei, hätte er in einem Gespräch mit den Autoren erfahren, redaktionell „einiges unter den Tisch gefallen“, was die Geschichte angeht: So hätten die Ressourcen, die abgebaut werden müssen keine Namen, viel der Hintergrundgeschichte, welche die Autoren sich zum Schattenrat ausgedacht hätten, sei nicht mit in die Anleitung übernommen worden. „Das ist ein bisschen schade“, sagt Fritsch. „Die Karten und die Thematik geben das schon her.“ Für ihn ist „Council of Shadows“ mechanisch „ein gehobenes Kennerspiel“. Eine der Stärken sei „eine sehr kurze Spielzeit“. Eine andere Stärke, die für ihn „ultra reizvoll“ ist, ist der Mix aus Spielmechaniken: „Es hat sehr viele Mechaniken drin, die ich so wirklich noch nie gesehen habe“, sagt Fritsch, unter anderem eben die Punkteleiste, auf der man sich selbst einholen muss. Man habe das Gefühl, sich selbst hinterherzurennen.
Ein Nachteil sei, dass die Punktedifferenz gerade in den ersten Partien sehr hoch ausfallen könne. „Allein schon die zweite Partie ist aber so komplett anders“, sagt Fritsch. „Das Spiel eignet sich nicht so sehr dafür, es zu spielen, wenn zwei Personen es schon kennen und eine nicht.“ Außerdem findet er, die Programmierung der Aktionen sei nicht ganz ausbalanciert. „Aber vielleicht will das das Spiel“, sagt Fritsch, „ich will das den Autoren gar nicht vorwerfen.“ Dennoch gäbe es einige sehr starke Karten, die, nach seiner Beobachtung, meist auch zum Sieg führten, und was er noch mehr ergründen möchte. Jedenfalls habe man nach zwei Partien noch nicht alles gesehen. Auch in der fünften, sechsten und siebten Partie habe er noch neue Ideen gehabt.³
Bernhard Löhlein findet zwei Dinge, „die dieses anspruchsvolle Spiel zu einem Besonderen machen: Zum einen wandern die Aktionskarten auf meinem Tableau. Ich kann nicht überall alles machen, vor allem, wenn meine Reichweite zu gering ist. Und zweitens: Es gibt zwei Leisten am Rande des Spielfelds: Die eine zeigt mir den Verbrauch an, so eine Art Umweltverschmutzung. Ich muss mich daher auf der anderen Leiste einholen.“ In seiner Radiorezension ist Löhlein begeistert von dem Spiel: „Ich liebe es, ich mag die originelle Idee mit den beiden Leisten, bin angetan von der Grafik, dieser Science-Fiction-Welt. Auch wenn es Ungenauigkeiten in der Regel gibt: Ich bin fasziniert von diesen unendlichen Weiten“, sagt er.⁴
 Nico Wagner und Stephan Kessler stellen sich der Herausforderung des Weltalls zu zweit. Wagner findet einen sehr klassischen Mechanikmix vor, mit Ausnahme des Einholmechanismus. „Den kannte ich in der Art und Weise noch nicht“, sagt er. „Cool“ seien auch die Technologieschübe, die es beim Einholen gibt. „Das wie so eine Karotte vor dem Esel. Wenn du erstmal weißt, was für einen Schub es da geben kann, umso mehr versuchst du, den Punkt zu erreichen, dass du so eine Karte kriegst.“ Allerdings sei der Ausgleich, den die anderen bekämen, zu klein. Dadurch ergäben sich große, teils unaufholbare Punktedifferenzen. „Die die vorne sind, werden noch mehr belohnt“, sagt er, und findet: „Ich habe das Gefühl, ich komme nicht richtig rein in das Spiel.“ Für Wagner ist es kein Spielvorteil, dass er das Spiel schon kennt. „Ich habe immer noch nicht den Bogen raus. Dieses Spiel macht mir ständig schöne Augen, aber es lässt mich nicht an sich ran. Das hatte ich lange nicht mehr bei einem Spiel, dass ich mich so schwergetan habe. Und so langsam verliere ich die Motivation.“ Außerdem ist ihm „Council of Shadows“ zu kleinteilig. „Es vermittelt den Eindruck, als könnte man sehr viel gleichzeitig machen, ich muss trotzdem ständig auf andere warten.“ Mechanisch sei es mit vier Personen am interessantesten, die Downtime sei hier aber am größten. „Wir haben einen hohen Grad an Interaktion, trotzdem wirkt das alles sehr nebeneinander.“ Am Ende resigniert er: „Mich spricht das Thema an, der Mechanismus, ich mag das alles, aber ich werde nicht warm damit.“
Nico Wagner und Stephan Kessler stellen sich der Herausforderung des Weltalls zu zweit. Wagner findet einen sehr klassischen Mechanikmix vor, mit Ausnahme des Einholmechanismus. „Den kannte ich in der Art und Weise noch nicht“, sagt er. „Cool“ seien auch die Technologieschübe, die es beim Einholen gibt. „Das wie so eine Karotte vor dem Esel. Wenn du erstmal weißt, was für einen Schub es da geben kann, umso mehr versuchst du, den Punkt zu erreichen, dass du so eine Karte kriegst.“ Allerdings sei der Ausgleich, den die anderen bekämen, zu klein. Dadurch ergäben sich große, teils unaufholbare Punktedifferenzen. „Die die vorne sind, werden noch mehr belohnt“, sagt er, und findet: „Ich habe das Gefühl, ich komme nicht richtig rein in das Spiel.“ Für Wagner ist es kein Spielvorteil, dass er das Spiel schon kennt. „Ich habe immer noch nicht den Bogen raus. Dieses Spiel macht mir ständig schöne Augen, aber es lässt mich nicht an sich ran. Das hatte ich lange nicht mehr bei einem Spiel, dass ich mich so schwergetan habe. Und so langsam verliere ich die Motivation.“ Außerdem ist ihm „Council of Shadows“ zu kleinteilig. „Es vermittelt den Eindruck, als könnte man sehr viel gleichzeitig machen, ich muss trotzdem ständig auf andere warten.“ Mechanisch sei es mit vier Personen am interessantesten, die Downtime sei hier aber am größten. „Wir haben einen hohen Grad an Interaktion, trotzdem wirkt das alles sehr nebeneinander.“ Am Ende resigniert er: „Mich spricht das Thema an, der Mechanismus, ich mag das alles, aber ich werde nicht warm damit.“
Auch für Kessler hat sich der Einholmechanismus frisch und neu angefühlt. „Dieses Konzept, dass ich in Vorleistung gehe, das finde ich interessant und toll. Ich muss überlegen: Will ich eine Karte spielen, die stark ist, aber den Marker weit nach vorne setzt? Oder eine die ein bisschen schwächer ist, damit ich eine Chance habe, den Marker wieder einzuholen?“ Man müsse sich genau überlegen, wie man dabei vorgeht. „Dieses Konzept finde ich genial.“ Doch alles andere „knirscht“, sagt Kessler, und zeigt sich inbesondere mit der Anleitung unzufrieden. „Ich habe selten ein Spiel gehabt, was ich so häufig neu spielen musste, weil ich einen Regelfehler drin hatte.“ Nach seiner Erfahrung sei er da nicht der einzige. Am Ende kommt er zu einem ähnlichen Schluss wie Wagner: Alle einzelnen Elemente seien „supercool“. Aber insgesamt habe das Spiel in seinem Herz kein Feuer entfachen können.⁵

