Aktuelles
Spielraum

Harald Schrapers, Karsten Grosser, Nico Wagner und Gastkritikerin Alexandra Kemmerer besprechen vier Spiele: „Comet“ von Peter Prinz (Funtails und Huch), „E-Mission“ von Matt Leacock und Matteo Menapace (Schmidt), „Ritual“ von Tomás Tarragón (Strohmann Games) und „Harmonies“ von Johan Benvenuto (Lillelud). Kemmerer berichtet als eine von drei Brettspielhamstern …
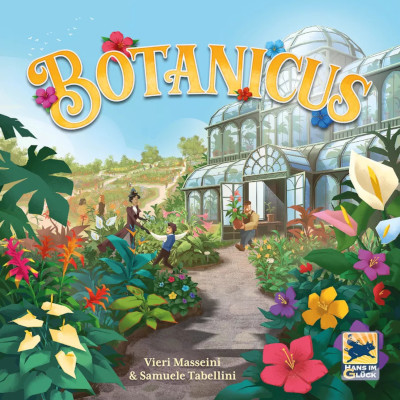
Bienen, Blumen und Besucher: In so einem botanischen Garten kann es schon mal stressig werden, gerade für die Gärtner:innen. Zum Beispiel bei „Botanicus“ (Samuele Tabellini und Vieri Masseini bei Hans im Glück): Hier muss ein botanischer Garten bepflanzt und gepflegt werden. Unsere Jurymitglieder haben in ihren …
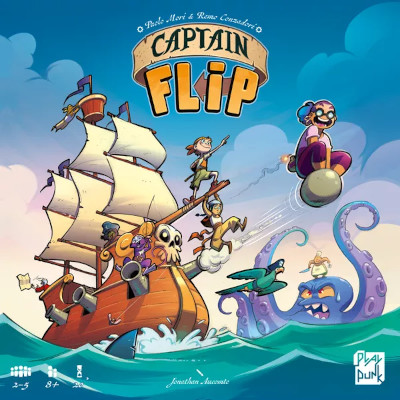
Eine gute Crew fürs Piratenschiff ist nicht einfach zu bekommen – gerade, wenn sie immer wieder durchwechselt und eher zufällig auftaucht wie in „Captain Flip“ (Paolo Mori und Remo Conzadori bei PlayPunk). Unsere Jurymitglieder haben sich in ihren jeweiligen Medien trotzdem mal die Kapitänshüte aufgesetzt und …
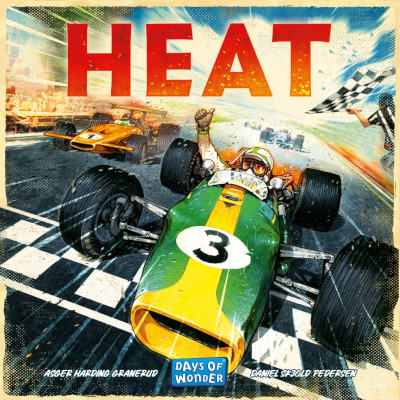
Motor hochdrehen, das Gaspedal durchdrücken und ordentlich Gummi auf der Straße lassen: „Heat“ (Asger Harding Granerud und Daniel Sjolkd Petersen bei Days of Wonder) riecht schon beim Ansehen der Packung nach Benzin und Asphalt. Unsere Jurymitglieder haben sich in ihren jeweiligen Medien ins Bolidencockpit gesetzt um …
Newsletter
Hier können Sie sich zum Newsletter anmelden:
Sie können den Newsletter jederzeit abbestellen:






